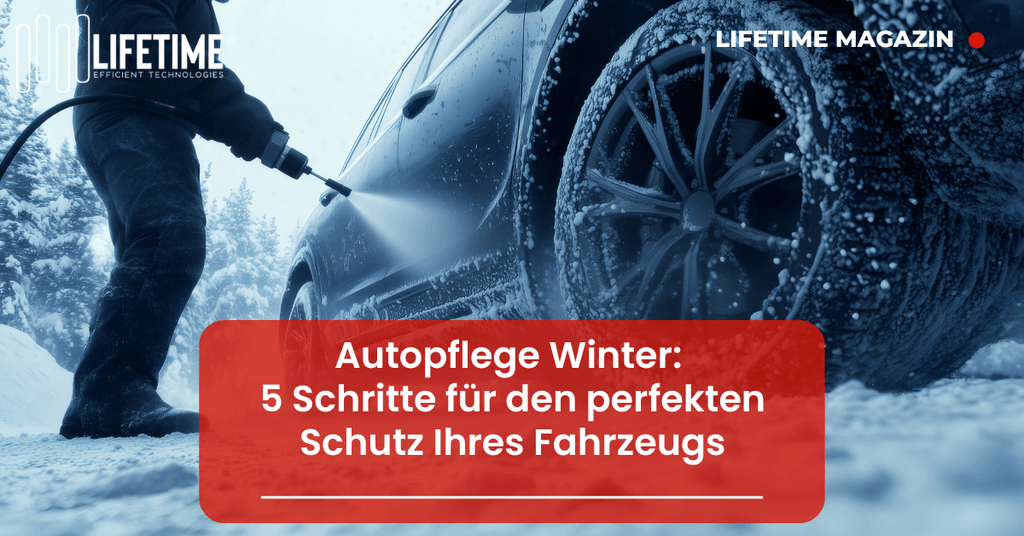Unfall – was nun? Die wichtigsten Schritte für Ihre Sicherheit
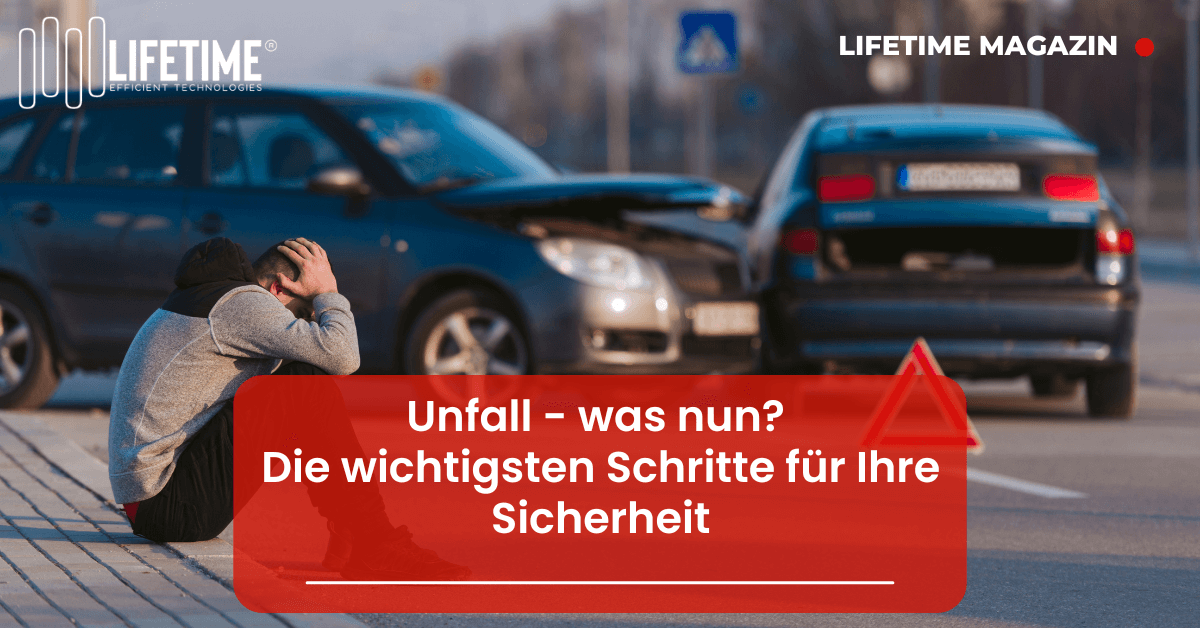
Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, ein lauter Knall – ein Autounfall passiert schneller, als man denkt. Unfall – was nun? In dieser stressigen Situation ist es entscheidend, Ruhe zu bewahren und systematisch vorzugehen. In diesem Ratgeber erfahren Sie Schritt für Schritt, was Sie nach einem Unfall tun sollten, um Ihre Sicherheit und die der anderen Beteiligten zu gewährleisten und die Unfallfolgen korrekt abzuwickeln. Egal ob Sie gerade einen Unfall gebaut haben oder unverschuldet hineingeraten sind – mit den folgenden Tipps behalten Sie den Überblick.
Inhaltsverzeichnis
- Unfallstelle absichern
- Erste Hilfe leisten
- Notruf absetzen
- Muss ich die Polizei rufen?
- Wenn keine Polizei gerufen wurde – was nun?
- Unfallbericht ausfüllen
- Beweisaufnahme und Fotos
- Verletzte und Zeugen notieren
- Technische Details zum Totalschaden
- Umgang mit der Versicherung
- Unfallmeldung an die Versicherung
- Schadenersatzforderungen verstehen
- Fazit
Sofortmaßnahmen nach einem Unfall
Ein Verkehrsunfall ist zunächst ein Schock. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich sofort um Sicherheit und Hilfe kümmern. Die folgenden Sofortmaßnahmen haben oberste Priorität, direkt nach dem Unfall:
Unfallstelle absichern
Ihre erste Aufgabe lautet: Weitere Gefahren verhindern und die Unfallstelle sichern. Schalten Sie umgehend die Warnblinkanlage ein und ziehen Sie eine Warnweste an, bevor Sie aussteigen. Anschließend sollten Sie diese Schritte befolgen, um den Unfallort abzusichern:
- Warndreieck aufstellen: Stellen Sie ein Warndreieck gut sichtbar auf. Innerorts etwa 50 m vor der Unfallstelle, auf Landstraßen ca. 100 m und auf Autobahnen mindestens 150 m – besser 200 m – entfernt vom Unfallort. So werden andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig gewarnt und Folgeunfälle vermieden.
- Fahrzeuge sichern oder entfernen: Schalten Sie bei allen beteiligten Fahrzeugen die Zündung aus und ziehen Sie den Schlüssel ab. Bei geringfügigen Blechschäden sollten Sie, wenn möglich, die Fahrzeuge rasch aus der Gefahrenzone (z.B. an den Straßenrand) bewegen, um den Verkehr nicht zu blockieren. Sind die Schäden größer oder Personen verletzt, lassen Sie die Fahrzeuge stehen und verändern Sie nichts an der Unfallstelle, bis die Polizei kommt.
- Eigenes Sicherheitsbewusstsein: Achten Sie stets auf Ihre eigene Sicherheit. Bleiben Sie hinter Leitplanken oder am Fahrbahnrand und halten Sie Abstand zum fließenden Verkehr. Insbesondere auf der Autobahn gilt: Bilden Sie zusammen mit anderen Fahrern eine Rettungsgasse, damit Feuerwehr und Rettungsdienst schnell zum Unfallort gelangen können.
Erste Hilfe leisten
Kümmern Sie sich im nächsten Schritt um Verletzte. Leisten Sie Erste Hilfe, soweit Ihnen dies möglich ist. Prüfen Sie, ob jemand verletzt oder bewusstlos ist, und sprechen Sie die Personen an. Versuchen Sie, Verletzte aus der Gefahrenzone zu bringen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Beruhigen Sie die Unfallopfer und geben Sie ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein – oft hilft schon Zuspruch, bis der Rettungsdienst eintrifft.
Als Führerscheininhaber sind Sie gesetzlich verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Unterlassen Sie notwendige Hilfe, machen Sie sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Wichtig: Wenn Sie alleine sind, setzen Sie zuerst den Notruf ab (siehe nächster Punkt) und leisten Sie dann Erste Hilfe. Sind mehrere Helfer vor Ort, können Aufgaben aufgeteilt werden (z.B. eine Person leistet Hilfe, eine andere ruft den Notruf). Decken Sie Verletzte, wenn möglich, mit einer Rettungsdecke aus dem Verbandskasten zu – die silberne Seite nach unten hält den Körper warm und verhindert Unterkühlung.
Notruf absetzen
Haben Sie die Unfallstelle gesichert und Erste Hilfe geleistet, rufen Sie so schnell wie möglich Hilfe. Wählen Sie 112, die europäische Notrufnummer, wenn Personen verletzt wurden oder Gefahr besteht – darüber erreichen Sie Rettungsdienst und Polizei. Schildern Sie dem*der Notrufdispatcher*in ruhig und deutlich die Situation. Orientieren Sie sich an den fünf W-Fragen, um alle wichtigen Informationen zu liefern:
- Was ist passiert (Unfall, Anzahl der Fahrzeuge, Art des Unfalls)?
- Wo ist der Unfallort (möglichst genaue Ortsangabe, z.B. Straße, Kilometerpunkt, Fahrtrichtung)?
- Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?
- Welche Verletzungen oder besonderen Gefahren liegen vor (eingeklemmte Personen, Feuer, etc.)?
- Warten auf Rückfragen – legen Sie nicht sofort auf, sondern warten Sie, ob die Leitstelle noch Informationen braucht.
Bei ausschließlich geringem Sachschaden ohne Verletzte können Sie auch direkt die Polizei über 110 informieren. Diese wird den Unfall aufnehmen. In jedem Fall gilt: Lieber einmal zu viel Hilfe rufen als einmal zu wenig. Falls Ihr Handy beim Aufprall verloren gegangen ist oder nicht funktioniert, nutzen Sie eine Notrufsäule (auf Autobahnen alle 2 km zu finden) oder bitten Sie andere Verkehrsteilnehmer um Hilfe beim Absetzen des Notrufs.
Umgang mit der Polizei
Die Polizei hilft, den Unfall aufzunehmen und den Verkehr zu sichern. Doch muss man bei jedem Unfall die Polizei rufen? Und was ist zu tun, wenn man keine Polizei verständigt hat? Im Folgenden klären wir, wann die Beamten benötigt werden und wie es ohne Polizeipräsenz weitergeht.
Muss ich die Polizei rufen?
Bei schweren Unfällen ist die Polizei immer zu rufen – das ist nicht nur ratsam, sondern zum Teil auch Pflicht. Verständigen Sie in folgenden Situationen unbedingt die Polizei:
- Wenn Personen verletzt oder getötet wurden (unbedingt auch Rettungsdienst alarmieren – siehe Notruf).
- Bei hohem Sachschaden oder komplett unklarer Schadenshöhe. Im Zweifel lieber Polizei hinzuziehen, damit alles offiziell dokumentiert wird.
- Wenn der Unfallgegner nicht kooperiert oder es Streit über den Unfallhergang gibt. Die Polizei sorgt für eine objektive Aufnahme der Situation.
- Bei besonderen Umständen: Unfall mit einem ausländischen Fahrzeug oder Mietwagen, Unfall unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder Schäden an staatlichem Eigentum (Leitplanken, Verkehrsschilder). In all diesen Fällen ist es sinnvoll oder vorgeschrieben, die Polizei einzuschalten.
Grundsätzlich besteht nicht bei jedem kleinen Blechschaden eine gesetzliche Pflicht, die Polizei zu rufen. Bei einem leichten Parkplatzrempler ohne Verletzte zum Beispiel können die Beteiligten den Vorgang unter sich regeln. Allerdings: Wenn eine Partei auf die Polizei besteht, muss der andere sich fügen und warten, bis die Beamten eintreffen. Auch manche Versicherungen verlangen bei größeren Schäden einen Polizeibericht. Im Zweifel also lieber anrufen – oftmals gibt die Polizei am Telefon auch eine Einschätzung, ob ein Ausrücken nötig ist oder nicht.
Wildunfall? Bei Wildunfällen (Zusammenstoß mit einem Reh, Wildschwein etc.) sollten Sie immer die Polizei verständigen. Sie benötigen für die Versicherung eine Wildunfallbescheinigung, die Polizei oder Förster ausstellen können.
Wenn keine Polizei gerufen wurde – was nun?
Bei vielen kleineren Unfällen einigen sich die Beteiligten darauf, keine Polizei zu rufen. Doch was bedeutet das für die weitere Abwicklung? Zunächst einmal: Entfernen Sie sich niemals einfach vom Unfallort – das wäre Fahrerflucht und strafbar, selbst bei einem kleinen Kratzer. Sollte der Unfall mit einem parkenden Auto stattfinden und der Halter/Fahrer nicht binnen 30min kommen, so müssen Sie die Polizei rufen, bevor Sie sich von der Unfallstelle entfernen.
Wenn beide Seiten einverstanden sind, den Unfall ohne Polizei zu regeln, sollten Sie folgende Schritte unbedingt beherzigen:
- Unfall selbst dokumentieren: Fertigen Sie gemeinsam mit dem Unfallgegner einen detaillierten Unfallbericht an (siehe nächster Abschnitt). Halten Sie alle relevanten Fakten fest, einschließlich Datum, Uhrzeit, Ort, Beteiligte, Schäden und Hergang.
- Beweise sichern: Machen Sie viele Fotos von der Unfallstelle und den Fahrzeugschäden aus verschiedenen Perspektiven. Je besser alles festgehalten ist, desto weniger Streit gibt es später.
- Daten austauschen: Notieren Sie Namen, Anschrift, Kfz-Kennzeichen und Versicherung des Unfallgegners und geben Sie Ihre eigenen Daten heraus. Auch ein Foto des Unfallgegners mit seinem/ihrem Personalausweis zur späteren Verwendung ist nicht verkehrt. Ohne Polizei ist dieser Personalienaustausch untereinander Pflicht.
Haben Sie keine Polizei gerufen, sollten Sie besonders sorgfältig vorgehen. Die Versicherung stützt sich im Schadensfall auf Ihren Unfallbericht. Gibt es später Unstimmigkeiten oder widersprüchliche Aussagen, fehlt ein offizielles Protokoll – das kann die Regulierung erschweren. Daher unser Rat: Auch ohne Polizei immer einen unterschriebenen Unfallbericht von allen Beteiligten anfertigen. Sollte der Unfallgegner sich weigern, Daten auszutauschen oder wegfahren, rufen Sie nachträglich doch noch die Polizei, um den Vorfall zu melden. So sind Sie auf der sicheren Seite.
Dokumentation des Unfalls
Eine gründliche Dokumentation ist das A und O nach jedem Unfall – vor allem, wenn keine Polizei vor Ort ist. Diese Unterlagen helfen bei der Schadensregulierung und Beweissicherung. Wichtig ist, alles Relevante schriftlich festzuhalten und Beweise zu sammeln.
Unfallbericht ausfüllen
Der Unfallbericht ist ein standardisiertes Formular, das in vielen Ländern Europas ähnlich aussieht. Idealerweise haben Sie solch einen Vordruck im Handschuhfach. Füllen Sie den Unfallbericht gemeinsam mit dem Unfallgegner vollständig und wahrheitsgemäß aus. Beide Parteien sollten ihre Version des Hergangs schildern – möglichst sachlich und ohne Schuldzuweisungen. Am Ende unterschreiben beide den Bericht.
Wichtig: Eine Unterschrift unter dem Unfallbericht ist kein Schuldeingeständnis, sondern bestätigt lediglich die Richtigkeit der Angaben. Daher keine Sorge: Sie dürfen (und sollten) den Bericht unterschreiben, auch wenn Sie glauben, nicht schuld zu sein. Geben Sie im Formular keine vorschnellen Schuldbekenntnisse ab und lassen Sie die „Schuldfrage“ am besten offen – das klären später die Versicherungen. Sollte der andere Fahrer sich weigern, einen Unfallbericht zu unterschreiben, notieren Sie trotzdem alle Informationen und füllen Sie das Formular soweit möglich allein aus.
Falls Sie keinen europäischen Unfallbericht zur Hand haben, tut es auch ein normales Blatt Papier. Notieren Sie alle wichtigen Details: Beteiligte Personen, Fahrzeuge, Schäden, Ort/Zeit und Hergang des Unfalls. Lassen Sie sich die persönlichen Daten zeigen (Führerschein, Fahrzeugschein, Versicherungskarte) und notieren Sie diese. Bestehen Sie darauf, dass beide Parteien eine Kopie oder Fotos des Berichts erhalten. Dieser Bericht ist später für die Versicherung essenziell, insbesondere wenn keine Polizeimeldung vorliegt.
Beweisaufnahme und Fotos
Für die erfolgreiche Schadensregulierung ist es unerlässlich, Beweise zu sichern. Machen Sie deshalb umfangreiche Fotos vom Unfallort und den beschädigten Fahrzeugen. Folgendes sollten Sie fotografisch festhalten:
- Fahrzeugschäden an allen beteiligten Autos, aus mehreren Winkeln.
- Unfallsituation: Übersichtsfotos der Unfallstelle mit Position der Fahrzeuge zueinander. Markieren Sie ruhig die Endpositionen der Fahrzeuge mit Kreide oder einem Gegenstand, falls Sie sie zur Seite fahren müssen.
- Spuren: Bremsspuren, Splitter, Trümmerteile oder andere Spuren auf der Fahrbahn.
- Umfeld: Straßenverlauf, Beschilderung, Sichtverhältnisse (z.B. bei einer Kreuzung, wo standen die Autos?).
Scheuen Sie sich nicht, lieber zu viele Fotos als zu wenige zu machen. Im Zweifelsfall sind eigene Bilder Gold wert, denn Sie können sich später nicht darauf verlassen, Fotos vom Unfallgegner zu bekommen. Achten Sie auch darauf, Kennzeichen und besondere Merkmale der Fahrzeuge zu dokumentieren. Wenn möglich, fotografieren Sie auch Dokumente wie Führerschein, Ausweis oder Versicherungsscheine des anderen Fahrers (oder notieren Sie die Daten). Diese Beweise erleichtern es der Versicherung, den Hergang nachzuvollziehen.
Verletzte und Zeugen notieren
Vergessen Sie neben Blech und Blechschaden nicht die menschliche Komponente: Halten Sie fest, ob und welche Personen verletzt wurden. Notieren Sie die Namen und Kontaktdaten aller Unfallbeteiligten – Fahrer, Insassen sowie eventuelle Verletzte. Wichtig: Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs nicht auch der Halter ist, sollten Sie beide Namen aufnehmen (z.B. Fahrer sowie der Fahrzeughalter laut Fahrzeugschein).
Ebenso wertvoll sind Zeugen: Oft halten andere Autofahrer oder Passanten kurz an, die den Unfall beobachtet haben. Bitten Sie Zeugen freundlich um ihre Aussage und notieren Sie Namen, Adresse und Telefonnummer der Zeuginnen und Zeugen. Unabhängige Zeugen können im Streitfall sehr hilfreich sein, um den Unfallhergang zu klären. Fragen Sie auch Anwohner oder Ladenbesitzer in der Nähe, ob sie etwas gesehen haben – manchmal melden sich Zeugen nicht von selbst.
Hinweis: Sollte der Unfallgegner sich unerlaubt entfernen (Unfallflucht begehen), versuchen Sie, das Kennzeichen und Details zum Fahrzeug/der Person zu notieren. Rufen Sie umgehend die Polizei und schildern Sie den Vorfall. In so einem Fall können Sie außerdem den Zentralruf der Autoversicherer unter 0800 2502600 anrufen. Dort lässt sich anhand des Kennzeichens ermitteln, bei welcher Versicherung das flüchtige Fahrzeug versichert ist – ein nützlicher Tipp, um Ihre Schadenansprüche doch noch geltend zu machen.
Totalschaden am Auto – was nun?
Ein besonderes Szenario nach einem Unfall ist der Totalschaden. Gerade als Gebrauchtwagenfahrer kann schon ein mittelschwerer Crash bedeuten, dass sich eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Doch was genau heißt Totalschaden, und wie geht es dann weiter?
Technische Details zum Totalschaden
Von einem Auto-Totalschaden spricht man, wenn das Fahrzeug so beschädigt ist, dass es entweder technisch nicht mehr reparierbar ist oder die Reparaturkosten in keinem sinnvollen Verhältnis zum Fahrzeugwert stehen. Man unterscheidet:
- Technischer Totalschaden: Das Auto ist physisch nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand reparierbar (z.B. deformierte Struktur). Oft kommt dies bei sehr schweren Unfällen vor – das Fahrzeug ist dann reif für den Schrottplatz. Der Restwert ist praktisch Null.
- Wirtschaftlicher Totalschaden: Das Auto könnte zwar repariert werden, aber die Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaffungswert (Zeitwert) des Wagens deutlich. Es wäre also teurer, das Auto zu reparieren, als ein vergleichbares Ersatzfahrzeug anzuschaffen. Dieses Szenario ist häufig bei älteren Gebrauchtwagen: Schon bei moderaten Schäden kann der Reparaturpreis höher sein als der aktuelle Wert des Autos.
Nach einem Unfall mit Verdacht auf Totalschaden wird in der Regel ein Kfz-Gutachter eingeschaltet. Dieser ermittelt den Wiederbeschaffungswert Ihres Fahrzeugs (den Marktwert unmittelbar vor dem Unfall) sowie den Restwert (den Wert des Wracks bzw. der verbliebenen Teile). Die Versicherung vergleicht diese Werte mit den voraussichtlichen Reparaturkosten.
Es gibt eine Faustregel, die sogenannte 130-Prozent-Regel: Wenn Sie an Ihrem Auto hängen, bezahlen manche Versicherungen ausnahmsweise eine Reparatur, obwohl es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist – allerdings maximal bis 130 % des Fahrzeugwerts. Voraussetzung ist meist, dass Sie das Fahrzeug tatsächlich reparieren und für eine gewisse Zeit weiter nutzen (oft mindestens 6 Monate). Ist der Schaden höher als 130 % des Wiederbeschaffungswerts, wird in aller Regel nicht mehr repariert, sondern der Schaden zum Zeitwert abgerechnet.
Umgang mit der Versicherung
Bei einem Totalschaden stellt sich natürlich die Frage: Wer zahlt jetzt was? Hier kommt es auf die Schuldfrage und Ihre Versicherungen an:
- Unverschuldeter Unfall: Hat der*die Unfallgegner*in den Totalschaden verursacht, zahlt dessen/ihre Kfz-Haftpflichtversicherung den Schaden an Ihrem Fahrzeug. Sie haben Anspruch auf den Wiederbeschaffungswert Ihres Autos (also den Betrag, um ein gleichwertiges Fahrzeug zu kaufen) abzüglich des Restwerts (den Erlös, den man für das Unfallauto noch erzielen könnte). Zusätzlich muss die gegnerische Versicherung auch Folgekosten tragen, z.B. Gutachterkosten, Abschleppkosten, Zulassungsgebühren für ein neues Auto und ggf. eine Nutzungsausfallentschädigung oder Mietwagenkosten für die Dauer, in der Sie kein eigenes Auto haben.
- Selbst verschuldeter Unfall: Haben Sie selbst den Unfall verursacht, zahlt Ihre eigene Versicherung den Schaden Ihres Unfallgegners (dazu später mehr). Aber was ist mit Ihrem eigenen Auto? Hier greift nur eine Vollkasko-Versicherung. Ihre Vollkasko übernimmt den Totalschaden am eigenen Wagen entsprechend den vertraglichen Bedingungen – meist ebenfalls zum Wiederbeschaffungswert minus Restwert. Beachten Sie, dass bei Inanspruchnahme der Vollkasko in der Regel Ihre Versicherungsprämie im Folgejahr steigt (Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts) und ein vertraglich vereinbarter Selbstbehalt abgezogen wird. Teilkasko-Versicherungen zahlen keinen Unfallschaden am eigenen Auto, es sei denn, es handelte sich z.B. um einen Wildunfall oder Elementarschaden, der von der Teilkasko abgedeckt ist.
Steht fest, dass ein Totalschaden vorliegt, können Sie entscheiden, was mit dem Fahrzeug geschieht. Oftmals übernimmt die Versicherung die Verwertung des Wracks: Sie erhalten dann die volle Entschädigung (Wiederbeschaffungswert) und das beschädigte Auto geht an die Versicherung bzw. einen von ihr beauftragten Restwertkäufer. Alternativ können Sie sich entscheiden, das Unfallauto zu behalten – zum Beispiel, um verwertbare Einzelteile zu nutzen. In diesem Fall wird Ihnen der Restwert vom Auszahlungsbetrag abgezogen (weil Sie diesen Wert ja selbst noch durch Verkauf des Wracks erzielen könnten).
Wichtig: Unternehmen Sie keine vorschnellen Schritte mit dem Unfallwagen, bevor die Versicherungsfrage geklärt ist. Melden Sie den Schaden Ihrer Versicherung (siehe unten) und warten Sie die Weisungen ab. Die Versicherung möchte ggf. einen eigenen Gutachter schicken. Lassen Sie das Auto bis dahin möglichst im Ist-Zustand. Entfernen Sie es aber natürlich von gefährlichen Stellen – bei Totalschaden wird es oft abgeschleppt. Die Abschleppkosten übernimmt je nach Unfallhergang die entsprechend zuständige Versicherung.
Versicherungsklärung
Nach dem ersten Schreck und der Sicherung aller Beweise fragen sich viele: Unfall – was nun mit der Versicherung? In Deutschland gilt die Pflicht, jeden Unfall der Kfz-Versicherung zu melden. Im Folgenden erklären wir, welche Versicherung wofür zuständig ist und wie Sie bei der Schadenmeldung vorgehen.
Grundsätzlich gilt: Melden Sie Ihrer Versicherung jeden Unfall, selbst wenn Sie glauben, keine Schuld zu haben. Ihre Versicherungsgesellschaft unterstützt Sie bei der weiteren Vorgehensweise. Entscheidend ist die Rolle der Kfz-Haftpflicht und der Kaskoversicherung:
- Die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers kommt für alle Personen- und Sachschäden des Unfallopfers auf. Das ist der gesetzlich vorgeschriebene Grundschutz: Haben Sie den Unfall verursacht, zahlt Ihre Haftpflicht die Schäden des anderen (und umgekehrt).
- Eigene Fahrzeugschäden sind nicht durch die Haftpflicht abgedeckt. Für den Schaden am eigenen Auto benötigen Sie eine Kaskoversicherung. Die Teilkasko deckt allerdings nur bestimmte Schadensarten (z.B. Diebstahl, Wildschäden, Glasbruch) und keine selbst verschuldeten Unfallschäden am eigenen Wagen. Eine Vollkasko hingegen übernimmt auch Unfallschäden am eigenen Fahrzeug, selbst wenn Sie selbst schuld waren (abzüglich Selbstbeteiligung).
Informieren Sie zur Sicherheit auch Ihre eigene Versicherung, wenn der Unfallgegner offensichtlich schuld war. So ist Ihr Versicherer im Bilde, falls es doch zu Streitfragen kommt oder der Gegner Ansprüche stellt.
Unfallmeldung an die Versicherung
Haben Sie alle Daten und Unterlagen beisammen, sollten Sie den Schaden sofort Ihrer Versicherung melden. Viele Versicherer haben 24-Stunden-Hotlines oder Online-Schadenformulare, über die Sie den Unfall unkompliziert anzeigen können. Zögern Sie nicht: In den Vertragsbedingungen ist üblicherweise eine Meldefrist von einer Woche vorgegeben – oft heißt es „unverzüglich“ melden. Um Problemen vorzubeugen, informieren Sie Ihren Versicherer am besten unmittelbar nach dem Unfall oder spätestens innerhalb weniger Tage.
Bei der Unfallmeldung machen Sie Angaben zum Unfallhergang, den Beteiligten und den Schäden. Orientieren Sie sich an Ihrem Unfallbericht: Dort stehen bereits alle wichtigen Fakten, die die Versicherung benötigt (Personendaten, Kennzeichen, Versicherung des Unfallgegners, Unfallskizze, Schadensbeschreibung etc.). Senden Sie Ihrer Versicherung Kopien des Unfallberichts und der Fotos, falls möglich. Je vollständiger Ihre Meldung, desto schneller kann der Schaden reguliert werden.
Falls Sie den Unfall nicht selbst verursacht haben, nehmen Sie parallel Kontakt mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung auf. Oft hilft Ihnen Ihre eigene Versicherung oder ein Rechtsbeistand dabei. Die gegnerische Versicherung wird einen Schadenbearbeiter zuweisen, der Ihre Ansprüche prüft. Bleiben Sie in regelmäßigem Austausch und reichen Sie alle geforderten Belege ein (Reparaturkosten-Voranschlag, Gutachten, Quittungen von Abschleppdienst oder Mietwagen etc.).
Wichtig: Halten Sie sich an Absprachen mit der Versicherung. Beginnen Sie zum Beispiel größere Reparaturen erst, wenn die Kostenübernahme geklärt oder freigegeben ist. Bei Unsicherheiten fragen Sie lieber einmal mehr beim Versicherungsbetreuer nach.
Was tun, wenn ich den Unfall verursacht habe?
Ein Unfall ist besonders belastend, wenn man weiß, dass man selbst den Fehler gemacht hat. Sie haben den Unfall verursacht – was nun? Zunächst einmal: Stehen Sie dazu, aber machen Sie keine übereilten Schuldeingeständnisse am Unfallort. Tun Sie das, was jeder Unfallbeteiligte tun muss – Unfallstelle sichern, Hilfe leisten, Polizei rufen (wenn nötig) und Daten austauschen. Geben Sie ehrlich Ihre Daten heraus und zeigen Sie Führerschein sowie Versicherungskarte vor. Alles Weitere läuft dann größtenteils über Ihre Versicherung ab.
Schadenersatzforderungen verstehen
Als Unfallverursacher sind Sie (bzw. Ihre Haftpflichtversicherung) verpflichtet, dem Geschädigten Schadenersatz zu leisten. Doch was kann der andere alles verlangen? Grundsätzlich muss der Geschädigte so gestellt werden, als wäre der Unfall nie passiert. Konkret kommen auf den Unfallverursacher bzw. dessen Versicherung insbesondere folgende Kosten zu:
- Fahrzeugreparatur oder Ersatz: Die gegnerische Haftpflicht übernimmt die Reparaturkosten des beschädigten Fahrzeugs. Ist es ein Totalschaden, erhält der*die Geschädigte den Wiederbeschaffungswert (Zeitwert) des Autos erstattet.
- Wertminderung: Bei neueren Fahrzeugen kann trotz Reparatur ein merkantiler Minderwert bleiben (weil der Wagen einen Unfall hatte). Auch diese Wertminderung wird erstattet.
- Abschlepp- und Bergungskosten: Musste das Fahrzeug des Unfallopfers abgeschleppt oder geborgen werden, zahlt dies ebenfalls die Haftpflicht des Schädigers.
- Nutzungsausfall oder Mietwagen: Kann der Geschädigte sein Auto vorübergehend nicht nutzen, hat er Anspruch auf einen Mietwagen für die Reparaturdauer oder eine Nutzungsausfallentschädigung (eine Pauschale pro Ausfalltag, je nach Fahrzeugtyp).
- Personenschäden: Bei Verletzungen werden Heilbehandlungskosten, Reha-Maßnahmen und ggf. der Verdienstausfall des Unfallopfers übernommen. Zudem hat ein Verletzter Anspruch auf Schmerzensgeld für erlittene körperliche und seelische Schäden. Die Höhe bemisst sich nach Art und Schwere der Verletzungen.
Die Palette an möglichen Schadenersatzforderungen ist also breit. Keine Panik: Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung tritt für berechtigte Forderungen ein und wehrt unberechtigte Forderungen ab. Es gehört zum Service der Haftpflicht, Sie vor überzogenen Ansprüchen zu schützen – man spricht vom „passiven Rechtsschutz“ der Versicherung. Melden Sie daher jeden Brief oder jede Forderung, die Sie vom Unfallgegner oder dessen Anwalt erhalten, umgehend Ihrer Versicherung. Dort prüft man die Sachlage und begleicht die Schäden im Rahmen der Policendeckung.
Behalten Sie im Hinterkopf, dass ein selbst verschuldeter Unfall künftig Auswirkungen auf Ihre Versicherungsbeiträge hat: Ihre Haftpflicht (und ggf. Vollkasko) stuft Sie in eine schlechtere Schadenfreiheitsklasse zurück, was den Beitrag erhöht. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, kleinere Schäden selbst zu bezahlen, um eine Rückstufung zu vermeiden – viele Versicherer erlauben es, einen regulierten Schaden innerhalb von sechs Monaten zurückzukaufen. Lassen Sie sich hierzu von Ihrer Versicherung beraten, falls nur ein sehr geringer Sachschaden entstanden war.
Zuletzt ein Tipp: Ziehen Sie bei komplexen Schadensfällen oder Unklarheiten einen Rechtsbeistand hinzu. Insbesondere wenn es um hohe Personenschäden oder strittige Abläufe geht, kann ein Fachanwalt für Verkehrsrecht Ihre Interessen vertreten. Die Kosten trägt bei unverschuldeten Unfällen übrigens meistens die gegnerische Versicherung. Und wenn Sie eine Verkehrs-Rechtsschutzversicherung besitzen, sind auch eigene Anwaltskosten bei Streitigkeiten gedeckt.
Fazit
Ein Verkehrsunfall ist ein einschneidendes Erlebnis – doch mit dem richtigen Verhalten schützen Sie sich und andere und stellen die Weichen für eine reibungslose Schadensabwicklung. Von den Sofortmaßnahmen (Unfallstelle sichern, Erste Hilfe leisten, Notruf) über das korrekte Verhalten mit oder ohne Polizei bis zur Dokumentation aller Details: Jeder Schritt ist wichtig. Auch die rechtzeitige Information der Versicherung sorgt dafür, dass Sie schneller wieder mobil sind und niemand auf seinem Schaden sitzen bleibt.
Mit diesem Wissen im Hinterkopf können Sie etwas beruhigter fahren – wohl wissend, dass Sie im Ernstfall nicht hilflos dastehen. Bleiben Sie sicher unterwegs! 🎉 Abonnieren Sie unseren Newsletter, um regelmäßig weitere hilfreiche Tipps rund ums Autofahren, Sicherheit und Fahrzeugpflege zu erhalten. So sind Sie stets gut informiert und vorbereitet.
Hinweis: Die gesetzlichen Regelungen können sich ändern. Im Zweifel oder Notfall sollten Sie immer die Polizei und Ihre Versicherung kontaktieren.